Wissenschaftsjournalismus in Norddeutschland
Aus der Nische ins Rampenlicht
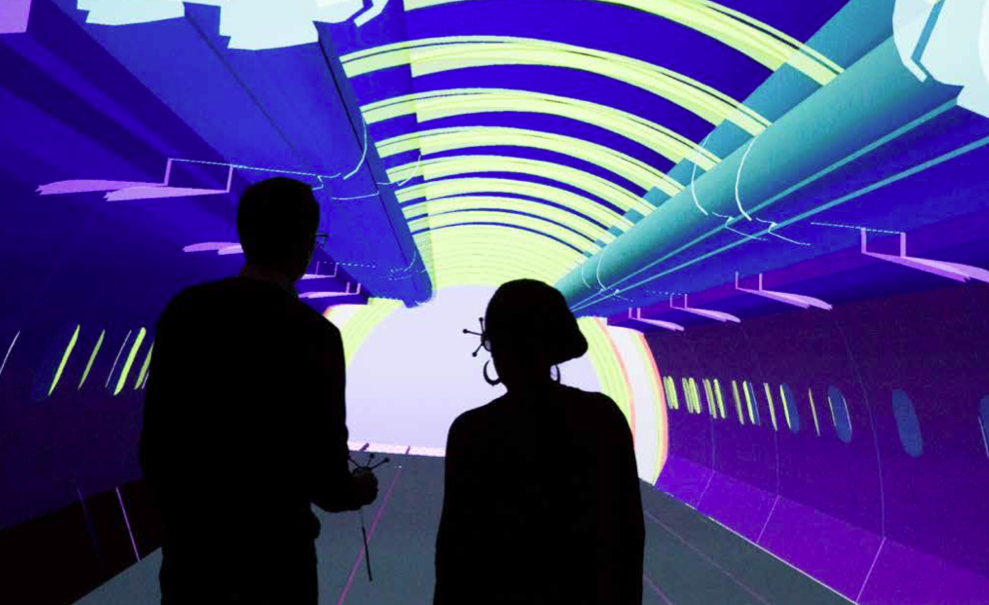
Virtuelle Realitäten im ZAL Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung: Eine Hamburger DJV-Gruppe war dort vor einiger Zeit zu Gast (Foto: Christina Czybik)
Corona hat die Arbeit von Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten sichtbarer gemacht. Doch ist sie in der Pandemie auch besser geworden? Die NORDSPITZE hat Kolleginnen und Kollegen zu ihren aktuellen Erfahrungen und Erwartungen für die Zukunft befragt.
„Natürlich freue ich mich darüber, dass Wissenschaftsjournalismus durch die Corona-Pandemie eine Aufwertung erfahren hat und jetzt als systemrelevant gilt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Erkenntnis in den Redaktionen bereits angekommen ist“, sagt Peter Spork, der laut Deutschlandfunk als einer der „führenden Wissenschaftsautoren hierzulande“ gilt. „Noch immer gelten Virolog*innen und Politiker*innen als ideale Corona-Expert*innen, obwohl sie nicht neutral sein können. Die Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist eigentlich unser Job.“ Der Hamburger, der im Bereich Neurobiologe und Biokybernetik promoviert hat, schreibt seit 30 Jahren für zahlreiche Zeitungen und Magazine, gibt den Newsletter Epigenetik und das Online-Magazin Erbe & Umwelt auf RiffReporter.de heraus und hat gerade sein achtes Sachbuch veröffentlicht. Zahlreiche Rückmeldungen hat er zu einem Kommentar bei RiffReporter.de bekommen, in dem er kritisiert, dass Journalistinnen und Journalisten zu viel über die Lockdown- und zu wenig über die Corona-Krise berichten würden.
„Bis vor nicht allzu langer Zeit galt Wissenschaftsjournalismus in vielen Redaktionen eher als nice to have“, stellt Monika Rößiger, freie Wissenschaftsjournalistin in Hamburg, aus eigener Erfahrung fest. „Das ist jetzt gerade anders – aber ich bin mir nicht sicher, ob das von Dauer sein wird.“ Aus dem Jahr mit der Pandemie habe sie die Lehre gezogen, dass sie als Wissenschaftsjournalistin wenig ausrichten könne, wenn es an Offenheit gegenüber naturwissenschaftlichen Erkenntnissen mangelt. „Das ist auch eine Frage der Bildung. Wenn die harten Fakten aus Biologie, Chemie, Physik nicht mehr ausreichend in der Schule unterrichtet werden, wirkt sich das negativ auf die Zukunft unserer Gesellschaft aus“, sagt Monika Rößiger. „Ebenso wichtig ist es, bereits in der Jugend die Werte von Aufklärung und Rationalität zu vermitteln. Das macht einen grundsätzlich weniger anfällig für Desinformationskampagnen im Netz, die sich oft schon durch einen totalitären, mystifizierenden Ton verraten.“
Für die Zukunft des Wissenschaftsjournalismus wünscht sich Monika Rößiger ganz einfach mehr Teamarbeit. „Angesichts der Komplexität vieler Themen, nicht zuletzt Corona mit all seinen Konsequenzen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, brauchen wir mehr interdisziplinäre Journalistenteams.“ Rößiger beschäftigt sich derzeit intensiv mit einem Zukunftsthema: der naturnahen Waldwirtschaft. „Wenn wir möchten, dass unsere Wälder sich an den Klimawandel anpassen können, brauchen wir mehr Wildnis, weniger Kahlschlag und weniger Förster“, gibt Rößiger Einblick in ihre Recherchen. „Es geht schließlich um unser aller Naturerbe.“
Die Gretchenfrage unter den norddeutschen Wissenschaftsjournalistinnen
und -journalisten scheint zu sein, ob man Ergebnisse aus der Forschung nach klassischen journalistischen Prinzipien mit einer Gegenposition versehen oder sie als unverrückbare Fakten betrachten kann. Peter Spork ist der Ansicht, dass Wissenschaftsjournalismus eine Aufklärungs- und Vermittlerrolle übernehme und damit eine riesige Verantwortung trage. „Wir sind diejenigen, die aufgrund unserer Kenntnisse entscheiden können und müssen, was berichtenswert ist und was nicht. Das müssen wir uns aber auch zutrauen und dürfen es nicht Interessengruppen überlassen.“ Wissenschaftsjournalisten dürften nicht meinen, zu jeder Position eine Gegenposition aufzeigen zu müssen, sei sie auch noch so abwegig. „Ein Bericht über den Planeten Erde benötigt keinen Hinweis darauf, dass einige Spinner noch immer behaupten, die Erde sei eine Scheibe“, sagt Spork.
Anders sieht das Beate Grübler, Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Neurologie und Krebserkrankungen in Hannover: Alle Formate, die eine Diskussion zwischen Wissenschaftlern ermöglichen, hätten durch die Pandemie an Bedeutung gewonnen. „Ich halte es für nicht verwerflich, sondern geradezu für erforderlich, dass Einschätzungen aus der Wissenschaft von Medien mit einer Gegenposition kontrastiert werden“, sagt Grübler. „Dass dabei auch ungeprüfte Forschungsergebnisse aus Einzelstudien uneingeordnet vermeldet wurden, mag geschehen sein, der Regelfall war es gewiss nicht.“ Schon vor Corona hätten sich viele Menschen für Forschungsthemen interessiert, sofern sie verständlich und anwendungs- bezogen aufbereitet wurden. Insofern nimmt der Wissenschaftsjournalismus für Beate Grübler keine Sonderstellung ein und sollte sie auch nicht haben. „In der aktuellen Situation müssen jedoch Unmengen an themenbezogenen Fakten in kurzer Taktfolge vermittelt werden – ich freue mich, dass das in den meisten Fällen auch gelingt, weil sich viele Journalisten gut in das Thema eingearbeitet haben“, sagt Grübler. „Manches ist mir zu reißerisch, zu unreflektiert, zu unausgewogen – aber das mag vielfach der Hektik geschuldet sein. Ich hoffe, dass wir bald aus dem Panik-Modus herauskommen, sich die Berichterstattung versachlicht und auch mehr Wissenschaftler zu Wort kommen, die nicht zum Corona-Beraterstab der Bundesregierung gehören.“
Ganz schlecht weg kommen bei den befragten Kolleginnen und Kollegen die Talk-Formate in der Corona-Pandemie: „Interviews und Podcasts, in denen einzelne Kolleg*innen mit einzelnen anerkannten Wissenschaftler*innen sprechen, funk- tionieren bei einem derart komplexen und wichtigen Thema gut“, urteilt Peter Spork in Hamburg. „Was überhaupt nicht gelingt, sind Talkshows, weil sie von Mei- nungsvielfalt leben. In der Wissenschaft geht es aber weder um Meinungen noch um Vielfalt. Es geht um Erkenntnisse, fachliche Kompetenz und Konsens.“ Künstler, Politiker und Wirtschaftswissenschaftler könnten nun mal zu Fragen der Virologie nichts beitragen. „Sie können schlimmstenfalls die unerhört wichtigen Aussagen niederbrüllen, wenn bei ‚Hart aber Fair‘ zum Beispiel ein neutraler Experte vier Interessenvertretern gegenübersitzt.“
Differenziert gesehen wird die Bild-Zeitung, deren umstrittene Berichterstattung über eine Studie des Virologen Christian Drosten über die Corona-Infektiosität von Kindern ein breites Medienecho bewirkt hatte: „Bei allen Vorbehalten gegen die Darstellungsweise der Bild war es doch in Ordnung, auf die Mängel der Studie hinzuweisen“, findet Medizinjournalistin Beate Grübler in Hannover. „Wenn ein Wissenschaftler vor lauter Medienrummel keine Zeit für eine Stellungnahme im Vorfeld findet, muss er damit leben können, dass Journalisten das Material verwenden, das ihnen unkommentiert vorliegt.“
Sie sei in der Pandemie ein großer Fan von FAQs geworden, sagt Tanja Krämer aus Bremen, Mitgründerin von RiffReporter.de: „Die Menschen brauchen in Bezug auf Symptome, Fallzahlen oder Impfung schnelle, klare Antworten ohne viele schöne Worte oder eine gelungene Artikel-Dramaturgie“, findet sie. „Wir sind als Wissenschaftsjournalistinnen hier
auch zu Service-Journalistinnen geworden. Wenn das dann ergänzt wird durch sachliche, informative Hintergrundstücke und Analysen, etwa warum gewisse Dinge in der Politik so gelaufen sind, wie sie sind, ist wirklich viel erreicht.“ Gleichzeitig sei es auch wichtig, dass die menschlichen Geschichten hinter den Zahlen erlebbar werden. „Wir haben bei RiffReporter
etwa mit 50survivors ein Projekt gehabt, in dem 50 Corona-,Überlebende‘ ihre Geschichte geteilt haben“, berichtet Tanja Krämer. „Das war sehr wertvoll, weil es die Pandemie auch emotional nachempfindbar machte – in einer Zeit, in der viele noch keine Bekannten oder Freunde hatten, die daran erkrankt waren.“
Für Tanja Krämer hat die Corona- Pandemie vor allem bewiesen, dass Wissenschaftsjournalismus zu lange als Nischenthema vernachlässigt wurde.
Sie fordert jetzt Nachbesserung in den Redaktionen: „Es hat sich gezeigt, dass
es fachlich kompetente Kolleg*innen braucht, um angemessen auf Situationen wie diese zu reagieren. Und dass diese nicht in ausreichendem Maße in allen Medien vertreten sind“, findet die RiffRe- porterin. „Dadurch sind dann auch Fehler in der Berichterstattung entstanden, die zum Teil gravierende Folgen haben können – etwa wenn ein Impfstoff wie
der von AstraZeneca nun einen schlechten Ruf in der Bevölkerung hat, auch weil Journalist*innen Studien nicht korrekt wiedergegeben haben.“ Wissenschaftsjournalismus sei eben nicht erst seit Corona systemrelevant – sondern schon immer. Tanja Krämer: „Unsere ganze Gesellschaft basiert auf Forschung und Entwicklung, wie könnte er es dann nicht sein?“
Florian Vollmers